Ad fontes · Die Reformatoren
Lerne auf einem Streifzug durch die Kirchengeschichte die fünf großen Reformatoren kennen und lasse dich von deren Glaubensmut inspirieren!
- 10 Themen
- 30-50 Minuten/Thema
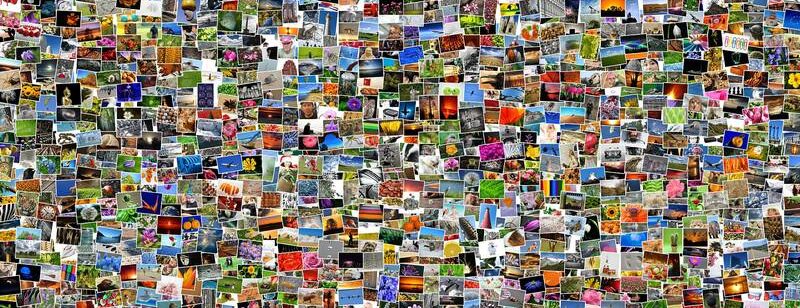
Wenn die Christenheit von der biblischen Lehre abweicht, ist es unvermeidlich, dass neue Kirchen entstehen, um sie zu reformieren.
Zu Anfang gab es nur eine Kirche, so wie sie im Neuen Testament beschrieben wird. In ihr bestanden zwar auch manchmal Uneinigkeiten, aber da die Apostel noch lebten, konnten sie stets anhand der Heiligen Schrift beigelegt werden (siehe z. B. Apostelgeschichte 15). In der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testaments lesen wir vom Gemeindeleben der damaligen Zeit.
Info
Über die Jahrhunderte schlichen sich zunehmend unbiblische und heidnische Traditionen in die Kirche ein.
Als die Apostel starben und der Einfluss des Heidentums und der griechischen Philosophie auf das Christentum zunahm, schlichen sich zunehmend unbiblische und heidnische Traditionen in die Kirche ein. So wurde beispielsweise die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele im 3. Jahrhundert n. Chr. von der Kirche aus der griechischen Philosophie übernommen (und 1515 n. Chr. auf dem 5. Laterankonzil zur Glaubenslehre der katholischen Kirche erklärt).
Auch andere Traditionen entwickelten sich erst nach der Zeit der urchristlichen Gemeinde: die Kindertaufe (3.-6. Jh.), das Messopfer für die verstorbenen Seelen (7. Jh.), die Lehre vom Fegefeuer (6. Jh.), der Ablass für die Sünden (12. Jh.), Wallfahrten (4. Jh.), die Vorherrschaft des Papstes, die Heiligenverehrung (4. Jh.), Bilderverehrung (8. Jh.), das Beten zu Maria, Rosenkranz und Ave Maria (12. Jh.), der Glaube, dass sie zum Himmel aufgefahren (1950) und Miterlöserin sei (1954) und anderes mehr. Die katholische Kirche hält diese Veränderungen für richtig. Päpste und Konzilien seien durch den Heiligen Geist geleitet worden, als sie diese Lehren beschlossen hätten.
Zu den Veränderungen zählte auch, dass sich in der christlichen Kirche eine Machtstruktur herausbildete. Gemeinden hatten sich in Gebieten zusammengeschlossen und an ihrer Spitze stand jeweils ein Bischof. Im Laufe der Jahrhunderte erhoben die Bischöfe der verschiedenen Gebiete den Anspruch, über den anderen Bischöfen zu stehen. Jeder hatte dafür gute Argumente: In Alexandria, Nordafrika, war das theologische Zentrum, in Jerusalem stand „die Wiege“ des Christentums, in Konstantinopel saß der römische Kaiser und in Rom waren Petrus und Paulus hingerichtet worden. Außerdem war Rom die eigentliche Hauptstadt des römischen Reiches.
Im Jahre 533 n. Chr. erklärte Kaiser Justinian den römischen Bischof zum „Haupt aller Kirchen“, um den Streit zu beenden. Der Bischof von Konstantinopel gab sich aber mit der kaiserlichen Entscheidung nicht zufrieden. Nachdem der Islam das Christentum in Palästina und Nordafrika praktisch ausgelöscht hatte und das römische Reich zerfallen war, blieben nur noch Rom und Konstantinopel übrig. Nach einigen Streitereien trennten sich die beiden Bischöfe und jeder kümmerte sich um sein eigenes Gebiet. So entstanden die römisch-katholische Kirche und die orthodoxe Kirche („orthodox“ bedeutet, die alte, ursprüngliche Lehre bewahren). Die erste Trennung in der Christenheit hatte ihre Ursache in den Machtansprüchen der Kirchenführer.
Neben der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche hatten sich außerhalb des römischen Reiches aber auch noch andere Kirchen gebildet, die auch auf das Urchristentum zurückgingen. Sie hielten nicht den Sonntag als Ruhetag (321 n. Chr. von Kaiser Konstantin als gesetzlicher Ruhetag im römischen Reich eingeführt), sondern feierten den Sabbat (siehe 1. Mose 2,2.3; 2. Mose 20,8-11). Diese Kirchen waren z. B. die armenische Kirche, die Thomaschristen in Indien, die Ebioniten in Palästina, die abessinische Kirche in Äthiopien und die iroschottische Kirche in Irland und Schottland. Einige dieser Gruppierungen existieren heute noch.
Aber auch in Europa machten nicht alle Christen die Veränderungen mit, einige hielten am ursprünglichen Evangelium fest. Sie mussten in den Untergrund gehen und sich verstecken, weil sie von der immer mächtiger werdenden Kirche sonst verfolgt wurden. Das ist eine tragische Entwicklung! Man hatte sich im Mittelalter sehr weit vom ursprünglichen Christentum entfernt. Zu diesen Untergrund-Christen zählten Waldenser, Albigenser, Katharer und andere.
In der Zeit der Reformation (16. Jahrhundert) und sogar schon davor wurden durch sogenannte „Reformatoren“ viele Missstände in der Kirche aufgezeigt. Bekannte Erneuerer waren: John Wyclif (England), Jan Hus (Böhmen), Martin Luther (Deutschland), Ulrich Zwingli und Johannes Calvin (Schweiz). Die sogenannten „Protestanten“ erhoben sich gegen unbiblische Traditionen und Machtmissbrauch. Sie setzen sich dafür ein, dass jeder selbst in der Bibel lesen kann und dass nicht Priester und Päpste alle Macht haben, sondern das Gewissen des Einzelnen. So entstanden die Reformierte und die Evangelisch-Lutherische Kirche.
Außerdem gab es damals sogenannte Wiedertäufer (Anabaptisten), die sich dafür einsetzten, dass man nicht von Geburt an einer Kirche angehört (durch Kindertaufe), sondern durch persönliche Entscheidung. Diese Gruppe wurde allerdings lange blutig verfolgt, auch von anderen Protestanten. Aus ihr gehen die späteren Mennoniten und Baptisten hervor.
Auch wenn die Rückkehr zur Bibel als Richtschnur des Glaubens von der Unterdrückung durch Rom befreite, kam die Reformation dennoch zum Stocken, als sich die großen protestantischen Kirchen zu sehr mit den Machthabern ihrer Länder verbanden und wiederum Andersgläubige unterdrückten.
Immer wieder kam es daher zu neuen Reform- und Erweckungsbewegungen, aus denen auch neue Kirchen hervorgingen, z. B. Methodisten, Baptisten, Adventisten und viele mehr. Daneben gab es zu allen Zeiten Splittergruppen und Sekten, die neuartige Lehren entwickelten, die nicht auf der Bibel basieren.
Vielfältigkeit
Die religiöse Landschaft ist vielfältig geworden, weil Christen ihren Glauben oftmals nicht allein auf die Bibel gründen.
Wenn man herausfinden will, welche Kirche die richtige ist, sollte es nicht nur darum gehen, wo man sich wohlfühlt oder wo das Programm am ansprechendsten ist. Es ist auch darauf zu achten, welchen Stellenwert die Bibel in dieser Gemeinschaft hat. Gilt sie als alleinige Richtschnur und Gottes Offenbarung? Wird sie von den Mitgliedern wirklich studiert und ernst genommen? Wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, kann man wirklich erbaut und im Glauben gestärkt werden.
Dass es so viele Kirchen gibt, hat geschichtliche Gründe. In manchen Kirchen bildeten sich Traditionen heraus, die nicht auf der Bibel basieren. Viele Kirchen anerkennen heute auch nicht mehr die Bibel als alleinige Richtschnur des Glaubens. Diverse Erweckungsbewegungen entdeckten Lehren der Bibel wieder und trennten sich so von den bereits vorhandenen Kirchen.
Ad fontes · Die Reformatoren
Lerne auf einem Streifzug durch die Kirchengeschichte die fünf großen Reformatoren kennen und lasse dich von deren Glaubensmut inspirieren!
